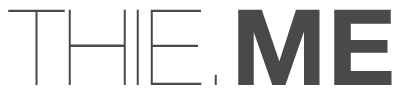Das Interview
Samstagmittag gegen zwölf, und eben entlocken mir Daphnes verzweifelte Weckversuche ein erstes Lächeln. „Och!“ prustet die Kleine mokiert: „Du bist ja munter, Papa, und läßt mich die ganze Zeit zappeln!“
Gespielt beleidigt dreht sie sich um, wirft den Kopf zurück und stolziert aus dem Schlafzimmer. Bevor sie die Tür hinter sich zu zieht, wirft sie mir noch einen schelmischen Blick zu und streckt „zur Strafe“ die Zunge heraus.
Eine Minute später steht sie strahlend mit einem umwerfend liebevoll präparierten Frühstückstablett neben dem Bett und schubst mich sanft auf die Seite. „He, ganz schön keck für einen Dreikäsehoch von vierzehn Jahren“, lache ich sie an und mache ihr Platz.
Nachdem sich meine schlaftrunkenen Augen an der Fülle des Tabletts ergötzt haben, entschärfe ich den Satz mit einem Gutenmorgenküßchen, und schon stürzen wir uns auf die frischen Brötchen, Honig, Eier und all die anderen Köstlichkeiten für eine dicke, pelzige Samstagmorgen-Zunge.
„Dieses Frühstück wird mir das Leben retten!“ unternehme ich einen Versuch, Daphnes Fleiß zu belohnen. Während ich einen kräftigen Schluck Kaffee nehme, erwidert sie augenzwinkernd: „Ja, und der ‚Dreikäsehoch‘ hat den Kaffee auch eben erst gebrüht, mit dem du dir gleich den Mund verbrennst.“
Zu spät! Meine Gier beschert mir wohl eines der häßlichsten Frühstücksgefühle dieser Welt: Der kochend heiße Kaffee versengt mir die Zunge und, weil ich ihn nicht lange im Mund behalten kann, auch noch die Speiseröhre und den Magen. Mein schmerzverzerrtes Gesicht entzückt Daphne derart, daß sie fast an dem Lachen erstickt, das sie sich verbeißt, und nach der ersten Schrecksekunde müssen wir beide losbrüllen.
Seit dem Autounfall, bei dem ihre Mutter ums Leben kam, ist sie mein ganzer Lebensinhalt. Zu Hause ist sie ein Engel, und die Schwierigkeiten mit den Lehrern in der Schule hat sie vermutlich ihrem losen Mundwerk und ihrem von einer dicken Portion Intelligenz unterstützten Selbstbewußtsein zu verdanken. Dabei hat sie ganz ausgezeichnete Noten, nur kann sie an der entscheidenden Stelle den Mund nicht halten.
Ich liebe Daphne von ganzem Herzen und bin mir nicht sicher, ob ich Elkes Tod ohne ihre Anwesenheit überhaupt überlebt hätte. Nachdem wir ausgiebig getafelt haben, schiebt sie das Tablett ans Fußende des Bettes, richtet sich halb auf und schaut mir besorgt in die Augen. „Du mußt heute das Interview machen, nicht wahr?“
Daphne weiß über all meine Arbeiten bestens Bescheid. Nach meinem letzten, ganzseitigen Artikel im „Kurier“ hatte ich ihr von meiner Wut über das heutige Interviewthema erzählt. Erschwerend war nun dazu gekommen, daß ich es offensichtlich mit einer Gesprächspartnerin zu tun haben werde, die in meinen Augen alles andere als angenehm sein wird. Auch darüber hatte ich mit Daphne gesprochen.
Nicht selten half mir bei beruflichen Konflikten, die zu Hause zur Sprache kamen, ihre jugendliche Leichtfertigkeit, Probleme zu entschärfen. So über meinen eigenen Schatten zu springen und wenigstens ab und zu abzuschalten, verdanke ich ihr. „Wird schon nicht so schlimm“, versuche ich abzulenken. „Ich helfe dir beim Abwaschen.“
Aber sie kennt mich besser, und mit ihrer unvergleichlichen Art, auf die Sorgen anderer einzugehen, redet sie mir die ganze Zeit in der Küche Mut zu, was sich wie immer erleichternd und in gewisser Weise auch belustigend auf mich auswirkt. Vermutlich würde ich auf der Stelle tot umfallen, würde mir ein ähnlich tragisches Schicksal meine Tochter entreißen, so wie ich vor Jahren Elke verlor.
Oft breiten sich deswegen in mir panische Angstzustände aus, wenn sie, wie heute, mit ihren Freunden wegfährt. So rede ich ihr zum Abschied noch mal ins Gewissen. Inzwischen donnert und brummt es in der Garageneinfahrt, als würde vor unserem Haus ein Motocrossrennen veranstaltet. Mit einem liebevollen Zwinkern verschwindet sie aus der Tür und läßt mich allein.
Mein zärtliches Abschiedslächeln wandelt sich, nachdem die Motorengeräusche in der Ferne verhallt sind, allmählich in groteskes Grinsen, in Anbetracht des bevorstehenden Nachmittags. Nach den Geschehnissen der letzten Wochen hatte ich gestern Abend einen kräftigen Schluck aus der Whiskeyflasche genommen. Genauer gesagt, stürzte ich die erste Hälfte in einem Zug hinunter, und der Rest verteilte sich auf vier Gläser innerhalb einer halben Stunde. Noch nie hatte mich eine Berichterstattung derart mitgenommen, daß ich die wirren, hämmernden Gedanken und drohende, wütende Gefühlsausbrüche im Alkohol ertränken mußte.
Ein bleischwerer Schädel und lächerlich unkoordinierte Bewegungen sind nun das Ergebnis dieser Schlacht. Ein heißes Bad, bei dem ich mir die sachlichen und emotionalen Argumente meiner Befragung zurechtlege, läßt allmählich wieder Leben in mich zurückkehren. Das Telefonat, bei dem ich vorgestern erstmals mit meiner heutigen Interviewpartnerin gesprochen hatte, verdunkelte jede Aussicht auf ein sachliches Gespräch.
Eine ältere Frau, Elvira Stöckel, keifte unzusammenhängend und aggressiv ins Telefon. In ihrer Verblendung und mit zunehmender Dauer ihres keinen Widerspruch duldenden Monologs, hatte sie nicht mit Beleidigungen und Anschuldigungen gespart. „Ihr Schmierfritzen habt ihn auf dem Gewissen ... einen anständigen Mann so zu beleidigen ... Sie hätten ihn mal erleben müssen, wie er mit den Kindern..."
„Das kann ich mir lebhaft vorstellen“, hatte ich mir da gedacht und mußte an die gräßlichen Bilder denken, die mir auf dem Polizeipräsidium vorgelegt worden waren. Von den Videos ganz zu schweigen. Rasende Wut hatte mich bei deren Anblick gepackt, und nachdem ich dem verantwortlichen Beamten mit Verständnis heischender Geste meine Visitenkarte gereicht hatte, war ich wutentbrannt und zum Bersten gespannt aus dem Präsidium gerannt.
Am gleichen Abend brüllte ich Daphne wegen einer Kleinigkeit an, es tat mir auf der Stelle leid. Kopfschüttelnd und mich mitleidig musternd hatte sie sich auf die Lehne meines Sessels gesetzt und gesagt: „Was muß das für ein Scheusal gewesen sein!“ Anschließend brachte sie zwei Tassen Tee ins Wohnzimmer, und ich redete mir alle Wut von der Seele, bis halb vier am Morgen.
In einer halben Stunde treffe ich also diese Frau Stöckel. Der Fotoapparat und das Diktiergerät liegen griffbereit auf dem Flurschrank. Nur hat sich der Autoschlüssel wieder mal verschanzt. Weil ich um Pünktlichkeit bemüht bin, fliegt der Inhalt aus vier Schubladen auf den Boden, bis ich den Schlüssel in der Jackentasche finde. „Jetzt nur ruhig bleiben!“
Unterm Scheibenwischer steckt ein Zettel von Daphne: „Mach sie fertig, Dad!“ Dabei muß ich an ihr intelligentes Mädchenlächeln denken, das sich, würde sie jetzt vor mir stehen, zu einem wahren Bollwerk der stärkenden Lebenshoffnung formen würde, und ich nehme mir vor, während des Interviews an Daphnes strahlende Augen zu denken.
Die Straßen sind wieder mal hoffnungslos verstopft. An die Wochenendeinkaufblechlawine habe ich wie üblich nicht gedacht, und die Einsicht schießt mir durch den Kopf: „Wenn du zu spät kommst, hast du schon im selben Augenblick verloren!“ Pünktlich fünfzehn Uhr betrete ich den Hausilur, über dessen Eingangstür die Nummer zweiunddreißig in Emaille gebrannt ist. Auf dem Treppenabsatz zum zweiten Stock baut sich eine dickliche, mittelgroße Frau auf.
Sie mag schätzungsweise gegen fünfundfünfzig Jahre alt sein, und ihr festtäglicher Aufzug verrät mir, daß sie Fernsehkameras erwartet hat. „Auch das noch!“ regt sich in mir eine Ahnung. Um sie von ihrer Enttäuschung abzulenken, lächle ich betont und begrüße sie eher etwas zu laut in schmeichelndem Tonfall: „Ah! Sie sind sicher Frau Stöckel, die Interviewpartnerin. Mein Name ist Behringer, vom ‚Kurier‘.“
Dabei wird mein Grinsen noch breiter, und ich fürchte, daß ich es ein wenig übertrieben habe. Ihr suchender Blick hinter mich, bestätigt meine Vermutung mit den Kameras, und so schiebe ich den Fotoapparat etwas mehr vor meinen Bauch. Das scheint sie fürs erste zu befriedigen, worauf sie mich tonlos bittet, ihre Wohnung zu betreten. Da sie hinter mir läuft, verpasse ich die Chance einer ersten Studie, und ich ertappe mich bei dem Wunsch, sie möge mich für eine Minute allein lassen, um in der Küche den Zucker zum Tee zu holen.
Stattdessen drängt sie mich ins Wohnzimmer und fordert mich mit einer stummen Geste auf, Platz zu nehmen. Statt dünnem Tee und edlem Gebäck entdecke ich auf dem Wohnzimmertisch einen Saftkrug und zwei Gläser. Keine bestickte Tischdecke, sondern ein Wachstuch liegt auf dem Tisch. Beim Hinsetzen fällt mein Blick auf den Feldstecher, der griffbereit auf dem Fensterbrett liegt. 'Na, das kann ja heiter werden!'
„Wie war noch mal Ihr Name?“ reißt mich ihre Stimme aus meinen Observierungen. „Behringer. Wir haben telefoniert.“ Obwohl es mir schwer fällt einen freundlichen Ton anzuschlagen, ringe ich mir ein nettes Lächeln ab. „Ich habe etwas Saft hingestellt, damit es beim Reden nicht staubt.“ Über diesen Lapsus kriegt sie sich fast nicht mehr ein vor Lachen. So blubbert sie vor sich hin, und irgendwie lache ich mit. Wenn auch mehr aus Freude darüber, daß die erste Verstimmung wohl überwunden ist. Um ihr einen Trumpf in die Hand zu spielen, entgegne ich gespielt verlegen: „Wissen Sie, ich mache diese Interviews auch nicht gerne. Aber in einer so netten Atmosphäre wird‘s schon nicht so anstrengend.“
Einen Augenblick lang verzieht sich ihr faltiges Lächeln. Dann rekelt sie sich zurecht, und feierlich, als würde sie ein Volksfest für eröffnet erklären, zirpt sie: „Na, dann lassen Sie uns mal anfangen, junger Mann.“ „Gut“, denke ich und versuche ihr Interesse anzuheizen, indem ich geschäftig in den Physikunterlagen meiner Tochter umherkrame und mit gewichtiger Miene behaupte: „Ihre Hilfe ist von hohem gemeinnützigem Wert, Frau Stöckel. Unsere Leser werden Ihre Bereitschaft schätzen“
„Ich abonniere den ‚Kurier‘ selbst seit fünfzehn Jahren.“ „Lügnerin“, schießt es mir durch den Kopf. Im Auszug unserer Versandabteilung der letzten zehn Jahre gab es weder einen Eintrag unter ihrem Namen noch unter dieser Adresse. „Na, das hört man gern, Frau Stöckel“, lüge ich zurück und werfe auf einmal meinen Plan über den Haufen, das Diktiergerät heimlich zu benutzen. Die Frage scheint mir riskant, aber wichtig: „Würde es Ihnen was ausmachen, wenn ich unser Gespräch mit dem Diktiergerät aufzeichne?“ „Aber nein. Ich will ja nicht schuld sein, wenn Sie sich die Finger wund schreiben müssen.“ Und wieder blubbert sie vor sich hin.
Gewonnen! Um etwas Zeit zu verschwenden und damit das Zepter vollends an mich zu reißen, schalte ich umständlich das Gerät ein und halte eine ebenso hochoffizielle wie überflüssige Einleitungsansprache. „23. August 1992. Frau Elvira Stöckel hat sich bereit erklärt, dem ‚Rhein-Kurier‘ ein Exklusivinterview im Zusammenhang mit dem Tod des Herrn Tillmann Neudorfer zu geben. Gegenstand des Gesprächs ist ihr nachbarliches Verhältnis sowie die vermeintlichen Umstände, die zum Selbstmord des Herrn Neudorfer führten.“
Darauf folgt eine Reihe von erfundenen Aktenzeichen und Redaktionsfloskeln, um ihr letztes Mißtrauen zu zerstreuen, endend mit den Worten: „Samstag, 23, August, fünfzehn Uhr fünfzehn. Uwe-Ernst Behringer, ‚RheinKurier‘.“
Sichtlich beeindruckt von dieser offiziellen und scheinbar professionellen Vorstellung fährt ihre linke Hand ungeduldig und Unsicherheit verratend auf ihrem linken Bein hin und her. „So ist‘s recht!“ bestätige ich mir selbst den Erfolg. Meine Fragen sollen sachlich und zielgerichtet sein. Zeit für ähnliche Ausbrüche wie neulich am Telefon will ich ihr nicht lassen.
Ich schlage Reporterton an: „Frau Stöckel, Sie sind die Nachbarin des am siebzehnten August verstorbenen Tillmann Neudorfer. Wie lange wohnten Sie mit ihm in diesem Haus?“ „Seit achtzehn Jahren.“ Überrascht von meiner rasanten Gangart, steckt ihr ein Kloß im Hals. Besser kann‘s nicht laufen.
„Wie war Ihr Verhältnis zu Herrn Neudorfer?“ „Nun, er war mein Nachbar“, stammelt sie. Mit Erleichterung registriere ich, daß sie der Situation nicht gewachsen ist. „Wie kamen Sie mit ihm zurecht? War er nett oder eher zurückhaltend? Lebte er in sich zurückgezogen oder hatten Sie auch persönlichen Kontakt?“ „Er war nett. Aber wir sahen uns nur zwei bis dreimal die Woche.“
„Frau Stöckel, wie Sie sicher wissen, war Herr Neudorfer in der Nachbarschaft als besonders engagiert bekannt. Können Sie unseren Lesern etwas dazu sagen?“ „Oh.“ Jetzt scheint sie weit ausholen zu wollen. „Er holte jedes Jahr im Sommer ein paar Kinder zu sich, arme Kinder. Meistens aus dem Waisenheim. Seit ein paar Jahren besuchten ihn sogar Kinder aus Rußland. Sie wissen schon, die aus Tschernobyl.“ „Zu welchem Zweck?“ „Na, um ihnen die Ferien zu verschönern. Herr Neudorfer war sehr kinderlieb.
Bis vor zwei Wochen die Polizei...
„Dazu kommen wir nachher, Frau Stöckel. Wie haben diese Kinder bei ihm gelebt? Haben Sie mit ihnen gesprochen?“ „Diese armen Würstchen haben doch sonst nichts. Und die russischen Kinder haben sich besonders gefreut, daß so ein guter Mann für sie da ist. Die hätten Sie mal sehen müssen, wenn er mit ihnen aus dem Zoo oder aus dem Kino nach Hause kam ...“ So schwärmt sie von dem gutmütigen, alleinstehenden Mann, der nichts anderes im Sinn hatte, als armen Kindern die Sterne vom Himmel zu holen. Frau Stöckel breitet die ganze Palette glückseliger Kinderträume auf der Wachstuchtischdecke aus, und ich muß wirklich an mich halten, sie nicht niederzubrüllen.
'Zu früh!' ermahne ich mich selbst. Einen Rausschmiß darf ich nicht riskieren, die Frau muß behutsam geführt werden. Mein Blick fällt auf den Videorecorder und den Fernseher in der Zimmerecke. Wie beschwörend liegt meine Hand auf der Tasche mit dem Videoband. 'Später!'
"Bis diese Polizisten hier waren, und von da an war er ein anderer Mensch. Ich sage Ihnen, wenn einem gutmütigen Menschen soviel Unrecht angetan wird, ist es kein Wunder, daß er durchdreht."
Inzwischen hat sie sich heiß geredet. Wütend fügt sie hinzu: „Ja, und dann die ganzen Schmierereien in den Zeitungen. Am Tag zuvor waren Leute vom Fernsehen in seiner Wohnung. Das hat er wohl nicht verkraftet.“
'Jetzt!' schießt es mir durch den Kopf. Aber Wut und Abscheu verbergend, nehme ich mir vor, den Präventivschlag behutsam einzuleiten. „Was empfanden Sie, als sie die Leiche entdeckten?“ Einen Moment lang hält sie den Atem an. Langsam greift ihre Hand nach dem Saftglas. Nachdem sie, wie zur Beruhigung, einen gierigen Schluck genommen hat, stöhnt sie: „Es war fürchterlich. Ich habe noch nie zuvor einen Toten gesehen. Sein Gesicht war so grau, entstellt, und ich..."
Nach Fassung ringend schüttelt sie heftig den Kopf und brüllt mich plötzlich an: „... und ihr Schweine habt ihn auf dem Gewissen!“ Darauf sinkt sie in sich zusammen.
Sekunden später entschuldigt sie sich für ihren Wutausbruch. Das ist die Gelegenheit einzugreifen! „0 Mann. Ihr Herr Neudorfer muß ein Heiliger sein!“
Überrascht schaut sie mich an. „Ich frage Sie, Frau Stöckel: Waren Sie jemals in der Wohnung Ihres Nachbarn? Haben Sie jemals sein ‚Studio‘ gesehen?“ Ohne eine Antwort zu erwarten, bereite ich meinen tagelang geprobten Angriff vor.
Ruckartig reiße ich das Videoband aus meiner Tasche, halte es in der linken Hand hoch und strecke die Rechte nach ihr aus. Lauter als ich will und heftig mit dem Band fuchtelnd schreie ich all meine Wut heraus: „Hier, liebe Nachbarin, sind die Aufzeichnungen des Wohltäters. Er war nicht nur ein Verbrecher aller übelster Sorte, sondern auch noch pervers genug, uns seine bestialischen Machenschaften auf Video zu hinterlassen. Hier, Frau Stöckel! Fünf Stunden wollüstige Abscheulichkeiten eines kindermißbrauchenden Monsters, drei Meter neben Ihrem Fernsehsessel aufgenommen“
"Das ist doch einfach..." will sie sich entrüsten. Aber durch nichts aufzuhalten, springe ich zum Videorecorder, schalte mit einer Handbewegung den Fernseher ein und stehe mit einem Satz hinter ihr. "Was ... was ... soll"‚ stammelt sie nur noch. Aber ich lasse sie nun nicht mehr zu Wort kommen. Ihren Kopf mit beiden Händen haltend, zwinge ich sie, in den Fernseher zu schauen. Immer noch rasend brülle ich erneut: „Schauen Sie hin! So sahen die glücklichen Ferienkinder aus! Verstrahlte, halbtote Kleinkinder, wehrlose Waisen. Ausgespuckt von der Gesellschaft. Ein gefundenes Fressen für einen Wahnsinnigen, der Ihr Nachbar war und jetzt Gott sei Dank endlich tot ist!“
Ich habe mich gehenlassen!
Mein Gebrüll muß man in der ganzen Straße gehört haben. Während die bestialischen Bilder über die Mattscheibe flimmern und markerschütterndes Kinderjammern meine Wut anstachelt, beginnt Frau Stöckel leise zu wimmern. Angesichts der unvorstellbaren Bilder und der satanischen Gerätschaften, die an und in den zerbrechlichen Körperchen grauenhafte Schmerzen verursacht haben müssen, ruft irgend etwas in mir erneut: 'JETZT!' Und diesmal folge ich der Stimme:
Leicht gebeugt schaue ich der weinenden Frau aus kürzester Distanz in die Augen. Meine Stirn berührt fast die ihre. Meine Hand hält ihr Kinn fest, so daß sie gezwungen ist, meinem Blick standzuhalten. Mit leise rollender Stimme, langsam und unvermutet überlegen, stelle ich die Frage: „Und Sie haben diese Schreie nie gehört?!“
Wie nach einem kräftigen Schlag sackt sie zusammen. Ihr Kinn fällt im gleichen Moment auf die Brust, als ich es loslasse. „Was sollte ich denn tun?“ haucht sie, als würde sie um Hilfe betteln. „Am Anfang hörte ich ab und zu Kinder weinen. — ‚Die armen Kleinen sind natürlich ganz verwirrt‘, hatte er immer gesagt.
Ein russisches Mädchen lief einmal nackt durchs Haus und weinte bitterlich. ‚Ein Anfall‘, war sein Kommentar. Aber so was passierte immer wieder, und da bekam ich Angst. Immer wenn ich diese Schreie hörte, drehte ich den Fernseher lauter oder ging in die Küche. Was sollte ich denn tun?“
Sich elend quälend, versucht sie ihrer Verzweiflung und Scham Herr zu werden. Beinahe väterlich lege ich ihr meinen Arm um die Schulter. In diesem Augenblick stürzt die ganze Welt über dieser Frau zusammen, und ich fühle, daß sie meine Solidarität braucht. Trotz allem Unverständnis, trotz der Wut ihr gegenüber bin ich plötzlich nicht mehr nur Ankläger. Plötzlich blickt sie mich flehend an. „Ich bin eine einsame Frau.“
Und nach einem kurzen Seufzer: „Er war nicht nur mein Nachbar. Manchmal kam er abends zu mir. Wir haben miteinander geschlafen. Können Sie sich vorstellen, wie das ist, niemanden zu haben? Gar niemanden?“
„Und deswegen haben Sie es ignoriert?“
Lautlos löst sie sich aus dem Sessel, läuft zum Fenster und blickt wie verloren auf die Straße. Ihr Zittern nimmt ein bedrohliches Ausmaß an. Plötzlich rutscht sie in sich zusammen und liegt bewegungslos am Boden.
Pechschwarz zieht eine schwere Regenwolke am abendlichen Himmel ihre Bahn. Laue, ozongetränkte Luftschwaden vermischen sich mit den Abgaswolken vorüberfahrender Autos. Ein dumpfer Druck hinter den Schläfen verrät die Anstrengung der letzten Stunden. Nachdem ich vergeblich versucht hatte, Frau Stöckel aus ihrer Starre zu lösen, rief ich einen Krankenwagen. Der junge Notarzt erkannte die Lage nach wenigen erklärenden Sätzen und verabreichte ihr eine hohe Dosis irgendeines Medikaments und nahm sie mit ins Krankenhaus.
Bei allem Schuldbewußtsein, ihr ein solches Schauspiel geboten und damit einen schweren Kollaps ausgelöst zu haben, hatte ich doch so etwas wie Genugtuung empfunden, als sie auf der Trage im Treppenhaus meine Hand festhielt.
Sie wird sich erholen, zumindest körperlich. Diese Frau Stöckel, die den einzigen Ausweg aus einer verzweifelten Einsamkeit darin sah, die finsteren Ereignisse neben ihrer Wohnungstür zu ignorieren, um wenigstens einmal im Leben das Gefühl haben zu dürfen nicht von aller Welt vergessen worden zu sein.
Aber sie wird bis an ihr Lebensende all die Qualen erleiden, die mit dem Begriff „Hölle“ nur ungenügend beschrieben sind. Die schreienden, gequälten Kinderseelen werden sie nicht zur Ruhe kommen lassen.
Zu Hause fällt mir Daphne in die Arme und begreift beim ersten Blickkontakt, daß kein noch so wohlwollendes Wort meine seelische Erschöpfung lindern kann. Nach einem stummen Abendessen fällt mein trüber Blick auf ihren schwarzen Haarschopf, die zarte, unschuldige Reinheit ihres Mädchenkörpers. Da ist mir die Angst wieder gegenwärtig, die ich vor Jahren zu bekämpfen hatte. Die grauenvolle Gewißheit, daß auch in mir Bewegungen stattfanden, die wohl so mancher noch so gute Vater gegenüber seiner hübschen Tochter mit Erschrecken in verborgensten, schwarzen Tiefen seiner Männlichkeit aufspürt.
Die Deutlichkeit dieses Bewußtseins, die offene Konfrontation mit bis dahin völlig unbekannten, fremden Strukturen meines unbewußten Innenlebens hatten mir damals einen Riesenschrecken eingejagt. Hemmungslose Offenlegung aller, bis dahin nicht für existent gehaltenen, abgründigsten Regungen der menschlichen Psyche hatte mir damals geholfen, Stellung zu diesen Fingerzeigen einer teuflischen Existenz in den Verstecken unseres Wesens zu beziehen. Diese dämonischen Elemente, in deren Abgründen Luzifers Wünsche nur darauf warten, durch geschwächte Kanäle ans Licht zu drängen, sind seitdem für mich Gegenstand zahlreicher Studien gewesen, was mir neben unzähligen schlaflosen Nächten auch einige Erkenntnisse brachte:
Jeder Wutausbruch, jede noch so unbedeutende Bosheit in unseren Worten sind Ausdruck eines im Menschlichen verankerten, dunklen Wesenszuges. Im Kampf gegen diese Kräfte benötigt jeder von uns, neben schonungsloser Offenheit gegen sich selbst, die Nähe des Anderen.
Lassen wir es nicht zu, nach allen Seiten und nach innen Offenheit und Ehrlichkeit wirken zu lassen, treiben wir uns gegenseitig einem Abgrund entgegen, dessen Tiefe wohl nur denen wirklich bekannt ist, die ihre Seele dort bereits verloren haben. Fehlt die stärkende Gewißheit der Geborgenheit und der Güte in uns, die von uns ausgehen und bestehen kann, brechen alle Höllen unserer ungezügelten Phantasie über uns herein.
Die Gesellschaft für diese Abgründe verantwortlich zu machen käme einem Selbstmord gleich. Denn wir sind nicht nur ihren Gesetzen unterworfen, sondern: Wir sind die Gesellschaft!
Irgendwann in der Nacht weckt mich das Klicken der Löschtaste am Diktiergerät, die ich vor dem Einschlafen gedrückt hatte. Die Erkenntnisse der schwachen Frau Stöckel bleiben somit allein bei ihr.
Meinem Chef werde ich morgen die Story mit der Nachbarin ausreden. Denn die einzig wirksame Methode, unseren Schwächen und eigenen Gefahren zu begegnen, ist die Toleranz und der Glaube an das fortwährend stärker werdende Gute in all unserem Sein, für das wir zeitlebens einzustehen haben.
*Hier klicken zum Start des Erzählungsbandes -> “M.O. Und andere Geschichten aus dem 4. Reich” von Jens Thieme, 1994.